In unserer Gesellschaft scheint Sterben eine Randerscheinung zu sein. Wir sprechen kaum darüber, und wenn, dann in Schlagzeilen, da ist jemand gestorben, und schon fragt man sich: Wer hat Schuld? Der Autobahnbetreiber, der die Beschilderung angebracht hat, der Hersteller, dessen Helm beim Sturz über den Felsen gebrochen ist, der Arzt, der die extrem seltene Krankheit übersehen hat, die Krankenversicherung, die sich geweigert hat, das 2-Millionen-Medikament zu bezahlen, die Familie, die den Suizid nicht vorhergesehen hat oder nicht verhindern konnte, das Altersheim, in dem die Hochbetagte seit zwei Jahren bettlägrig vor sich hinvegetierte, als sie eine tödliche Lungenentzündung bekam?
Der Tod: eine medizinische Panne?
Obwohl das einzige, was im Leben sicher ist, eben die Tatsache ist, dass wir eines Tages sterben werden, scheint der Tod heute eine medizinische Panne zu sein: etwas, das um jeden Preis zu verhindern ist. Da wird eine weitere Chemotherapie angesetzt und den Angehörigen gesagt: „Wir tun alles, was wir können“, anstatt dass man ihnen und dem Betroffenen achtsam erklärt, dass es gut wäre, sich Zeit füreinander zu nehmen und diese Zeit zu genießen, bei ordentlicher Lebensqualität, und sich dann liebevoll zu verabschieden. Stattdessen werden immer wieder alte Menschen, die bereits schwerst erkrankt sind, die nicht mehr selbst essen können, niemanden mehr erkennen, noch sterbend ins Krankenhaus gefahren, um dort reanimiert zu werden. Falls es klappt, leben sie noch schlechter als vorher und nicht mehr lange. Falls es nicht klappt, sterben sie im Krankenhaus umgeben von Lichtern, Hektik, Apparaten und fremden Menschen, anstatt umgeben von den Menschen, die ihnen am nächsten sind. Meiner Großmutter ging es so. Sie war schwer dement, schwerst depressiv, kreuzunglücklich. Als sie nachts im Altersheim einen Schwächeanfall hatte, der sie hätte ruhig sterben lassen, wurde der Krankenwagen gerufen, sie hektisch eingeladen. Sie starb auf dem Weg ins Krankenhaus unter Blaulicht. Erst danach später erfuhren wir davon, und ich sah sie wieder im Kühlraum des Krankenhauses, wohin man ihre Leiche gebracht hatte. Dort lag sie auf einer Metallbahre. Unwürdig, traurig, schwer zu fassen.
Die andere Großmutter starb ebenfalls alt und krank. Sie war klar bei Verstand, aber müde und litt seit Jahren unter starken Schmerzen. Sie wollte nicht mehr und hörte auf zu essen, bis sie ebenfalls vor Schwäche starb – friedlich und geborgen. Ihre Familie war da, sie wurde liebevoll begleitet. Ihr Arzt hatte uns gesagt, dass es zu Ende gehen würde, sie wusste es, wir wussten es, und verbrachten intensive, nahe und traurige Tage miteinander. Gleichzeitig sehr erfüllend und stimmig. Traurig war ich auch, sogar sehr. Aber auch voller Frieden.
Dem Leben mehr Tage, oder den Tagen mehr Leben?
In eine Gesellschaft, die versucht, den Tod zu verdrängen und fieberhaft nach Möglichkeiten sucht, das Leben um möglichst viele Tage wenn nicht endlos zu verlängern, anstatt sich dafür zu interessieren, wie das Leben sinnvoller und reicher werden kann, und wie gutes Sterben gelingt, in eine Gesellschaft, die das Sterben in Altersheime und Krankenhäuser abschiebt und davon nichts sehen und hören möchte, schlägt ein Virus wie Corona ein wie ein Donnerschlag. Anfangs unkontrollierbar, lässt es die verdrängte Angst vor dem Sterben brutal aufflammen. Was verdrängt ist, davor haben wir Horror. Macht uns dieses Virus bewusst, dass Sterben eine Möglichkeit ist, für uns alle, und können wir damit nicht umgehen, zeigen wir eine der Reaktionen, die bei Angst biologisch zur Verfügung stehen: Flucht (Distanz, Barrieren, Masken, anderen ausweichen, Krankenhäuser meiden (das hat viele Menschen in akuten Notsituationen in den letzten Monaten das Leben gekostet!)), Angriff (Aktionismus oder Kampf gegen anders Eingestellte) oder Totstellen (zuhause verschanzen und verstecken, so tun als wäre alles normal und auch bald alles wieder gut).
Keine dieser drei Reaktionen führt zu vernünftigen Entscheidungen, keine zu den richtigen Fragen, und wenn Angst dann auch noch medial geschürt wird, wie wir das gerade erleben, bunkern wir Toilettenpapier, anstatt uns dem zu stellen was ist: Wir leben, und wir können sterben. Jeden Tag. An einem Unfall, einem Virus, an Krebs, bei einem Anschlag, an einem Schlaganfall, an Herzstillstand, einfach so. Vielleicht im Moment eher an einem Virus als an einer nuklearen Katastrophe. Es kann jederzeit passieren, und natürlich können wir durch eine gesunde Lebensweise ein Stückweit dafür sorgen, dass die Chance, gesund alt zu werden, etwas höher wird. Aber wir haben eben keine Kontrolle darüber. Eines Tages werden wir sterben, und es wäre gut, uns lieber heute als morgen mit dieser Tatsache auseinanderzusetzen.
Was würdest du tun, hättest du noch genau ein Jahr?
Ich stelle Menschen manchmal die Frage: Was würdest du tun, wenn du ab heute noch genau ein Jahr zu leben hättest, bei guter Gesundheit? Wer sagt: „ich würde genau das Gleiche tun, was ich die letzte Zeit getan hat“, ist mit seiner Endlichkeit im Reinen. Wer merkt, dass er vieles anders machen würde, dass er noch viel zu klären hat, anderen viel zu sagen, der ist gut beraten, damit sofort anzufangen. Wer Angst vor dem Sterben hat, hat nämlich eigentlich Angst vor dem Leben: Er lebt es nicht wirklich und schiebt es auf, tut nicht das, was wirklich wichtig ist. Und ist dann natürlich auch nicht darauf vorbereitet, das Leben zurückzulassen, wenn es an der Zeit ist. Das lehrt der Psychologe Wolf Büntig, und ich denke, er hat Recht.
Übrigens ist das Geheimnis eines langen Lebens schon lange gelüftet: Neben allem, was das Immunsystem stärkt, also gesunder Ernährung, Bewegung und so weiter, ist es ein Faktor, der alle anderen überstrahlt: Menschliche Nähe und gute Beziehungen. Genau die wollen wir uns jetzt verbieten, aus Angst vor dem Virus? Genau das verbieten wir jetzt unseren Kindern? Ich finde: Es ist Zeit umzudenken, den Tod als solchen wieder als Teil des Lebens annehmen, und uns um das zu kümmern, was am wichtigsten ist: Menschen, die uns am Herzen liegen, Nähe und Geborgenheit und Gemeinschaft! Das fordert uns auf, so zu leben, wie es wirklich richtig ist, das zu tun, was unser Leben sinnvoll macht und uns diese Frage immer wieder zu stellen.
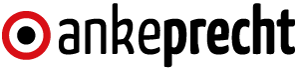




1 Kommentar zu „Hat der Umgang mit Corona mit der Verdrängung der Endlichkeit zu tun?“
Darum ist eine Patientenverfügung so wichtig. Da kann vorab bereits alles geregelt werden und niemand drittes muss eine Entscheidung für einen die treffen.